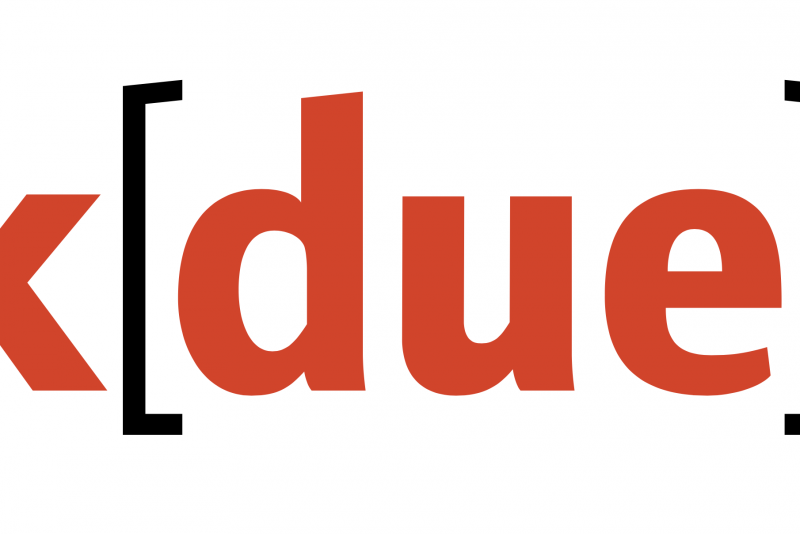Der Dokumentarfilm DAS GEGENTEIL VON GRAU zeigt den anderen Pott.
Interview mit dem Filmemacher Matthias Coers.
Brachflächen, Leerstand, Anonymität, Stillstand – nicht alle wollen sich damit abfinden. Im Gegenteil. Immer mehr Menschen entdecken Möglichkeiten und greifen in den städtischen Alltag ein. Ein Wohnzimmer mitten auf der Straße, Nachbarschaft, Gemeinschaftsgärten. Stadtteilläden, Repair Cafés und Mieter*inneninitiativen, anarchistische Zentren entstehen in den Nischen der Städte – unabhängig, selbstbestimmt und gemeinschaftlich. Der Dokumentarfilm „Das Gegenteil von Grau“ (1) zeigt unterschiedliche Gruppen, die praktische Utopien und Freiräume im Ruhrgebiet leben und für ein solidarisches und ökologisches Miteinander im urbanen Raum kämpfen. Der Filmemacher und Soziologe Matthias Coers (2) hat schon mit seinem Vorgängerfilm „Mietrebellen“ für Furore gesorgt. Mit ihm sprachen im Studio des Medienforums Münster Graswurzelrevolution-Redakteur Bernd Drücke und GWR-Praktikant Merlin Sandow. Technik: Detlef Lorber. Die Radio Graswurzelrevolution-Sendung wurde am 28.9.2017 im Bürgerfunk auf Antenne Münster ausgestrahlt und ist in der Mediathek des Medienforums dokumentiert. (3) Wir veröffentlichen eine redaktionell überarbeitete Fassung des Interviews. Eine um weitere Fragen und Antworten erweiterte Version erscheint voraussichtlich im Oktober 2018 im Unrast-Verlag in dem von Bernd Drücke herausgegebenen Buch „Anarchismus Hoch 4“. (GWR-Red.)
Bernd Drücke: Matthias, Du hast gerade Deinen neuen Film „Das Gegenteil von Grau“ in die Kinos gebracht. Kannst Du ein bisschen was zum Film erzählen?
Matthias Coers: Ja, der Film ist eine Co-Produktion mit einer Initiative aus dem Ruhrgebiet, eine Art Netzwerk – „Recht auf Stadt Ruhr“. Der Name ist Programm. „Das Gegenteil von Grau“ stellt unterschiedliche Initiativen im Ruhrgebiet vor, die im weitesten Sinne, man kann sagen mit Transition-Town-Aspekten, aber auch mit sozialen Kämpfen, mit Wohnungsfragen, mit Fragen zu Geflüchteten zu tun haben. Da werden Initiativen porträtiert. Das Ganze ist ein Kinofilm geworden, der aber nicht nur in Kinos gezeigt wird, sondern auch an unterschiedlichen Orten, auch in wissenschaftlichen Kontexten und in Nachbarschaften. Mein Motto ist: „Ein Film soll da laufen, wo er gebraucht wird.“ Also auch bei politischen Initiativen oder Interventionen. Es ist auch als politischer Film gedacht.
Bernd: Es gibt einen großen Bedarf nach diesem Film. Er kam genau zur richtigen Zeit. Ein Thema des Films ist die Gentrifizierung im Ruhrgebiet. Wenn wir das Ruhrgebiet mit der Unistadt Münster vergleichen, gibt es große Unterschiede. Der Durschnittsmünsteraner muss über 20 Prozent seines Geldes für die Miete ausgeben. Im Ruhrgebiet sind es durchschnittlich etwa 10 Prozent. In der Provinzmetropole ist die Gentrifizierung also schon weiter vorangeschritten. Hier gibt es weniger Leerstand als im Ruhrgebiet. Du kennst beide Regionen: Münsterland und Ruhrgebiet, wie würdest Du sagen, sind da die unterschiedlichen Perspektiven?
Matthias: Das Besondere am Ruhrgebiet ist, dass es einen großen Bruch gibt. Es war die wichtigste Industrieregion der Bundesrepublik. Es ist immer noch ein wenig Industriegebiet, aber früher war es eine Hochlohnregion, Stahl, Kohle – alles was gebraucht wurde. Diese Arbeitsplätze sind mehr oder minder weg. Sie existieren auf der Welt vielleicht in China oder Bangladesch. Die Struktur der Arbeit hat sich gewandelt.
Im Vergleich dazu sind Städte wie Münster, die eher traditionelle Dienstleistungs-, Verwaltungs-, Universitätsstädte mit einer großen Beamtenschaft sind, anders dran und haben ganz andere Möglichkeiten: Die Leute sind relativ versorgt und das Leben funktioniert. Auch wenn einzelne Kosten hoch und auch, wenn sie für nicht wenige Menschen in einer Stadt wie Münster ein Armutsrisiko sind, wie die Wohnkosten. Aber im Ruhrgebiet gibt es einen Bruch. Seitdem jetzt eine der letzten großen Fabriken wie Opel Bochum zugemacht hat, wissen alle, es hat sich radikal etwas geändert. Die Städte versuchen dagegen zu arbeiten mit dem Label „Metropolregion“, mit „Industriekultur“, mit vielen Ebenen, Events und so weiter. Aber es ist doch eine große Leerstelle da. Viele Leute sind außerhalb der Arbeit, die jüngere Generation ist kaum mit dieser verdichteten Industriearbeit in Berührung gekommen.
In diesen Nischen entstehen kleine Initiativen, die versuchen etwas Anderes zu machen. Diese stehen nicht allein, es gibt hier weltweit Ansätze und Bewegungen. Das Ruhrgebiet ist quasi prototypisch für eine solche Region. So einen Film kann man nicht so leicht über Münster machen, weil es eine Stadt ist, die im Moment noch gut zurecht kommt, trotz aller Widersprüche in der „sozialen Marktwirtschaft“ oder im Kapitalismus.
Bernd: Der Film ist stark. Zwanzig unterschiedliche Projekte werden vorstellt. Die Dichte der dargestellten Projekte ist überwältigend. Wenn man mit schlechter Laune in die Filmvorführung geht, kommt man mit guter wieder raus. Das Ruhrgebiet ist ja eigentlich nicht bekannt dafür, dass es dort heute eine lebendige soziale bis sozialrevolutionäre Bewegung gibt. Da erzeugt dieser Film einen ganz anderen Eindruck.
Matthias: Ja, ein bisschen liegt es am Medium Film selbst. Auch ein Dokumentarfilm ist immer Schnitt und damit auch Illusion und ein Stück Manipulation, aber so war es gar nicht gedacht. Das Besondere ist, dass sehr unterschiedliche Projekte zusammenkommen. Darin liegt eine gewisse Stärke. Das heißt, das sind einerseits Menschen, die für ihre Mietwohnung streiten und gleichzeitig Leute, die auf einem Wagenplatz leben. Das sind unterschiedliche Konzepte, Vorstellungen, Lebenskulturen, politische Entwürfe und Mentalitäten. Das ist im Film zusammen. Dadurch, dass es zusammenkommt, und der Betrachter das sieht, geht dieser ganze Reichtum auf. Es ist eine Geschichte z.B. von einem Lernbauernhof und von einer solidarischen Landwirtschaft. Wo auch über den alten Bauern, den Vater des Betriebs, geredet wird vom Sohn. Der Sohn emanzipiert sich auf eine Art schon, hat aber die Arbeit, die er kennengelernt hat. Die Arbeitsweise weiß er zu schätzen, da drin steckt Potential, das gibt er wieder weiter an die Kinder. Der Sohn hat ein ganz anderes Konzept. Von einem Bauernhof alleine könnte er vermutlich gar nicht leben, also macht er einen Lernbauernhof. Da dockt sich dann wieder eine städtische Initiative aus Dortmund an, um solidarische Landwirtschaft zu machen. So gibt es bestimmte Links und Vernetzungen, die möglich sind.
Bernd: Ich habe den Eindruck, dass der Film jetzt schon einiges im Ruhrgebiet bewegt. Er verstärkt ein Zusammengehörigkeitsgefühl der Ruhrgebietsszene und dargestellten Projekte. Wenn man das Ruhrgebiet heute sieht, dann ist es ja so, dass viele gar nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden wollen. Das sieht man an den Autobahn-Schildern, wenn man z.B. von Münster ins Ruhrgebiet fährt. Früher stand auf dem braun-weißen Schild bei Hamm „Ruhrgebiet“, heute steht da „Metropole Ruhr“. Das wurde so yuppie-mäßig verändert, weil der Begriff Ruhrgebiet wahrscheinlich Assoziationen weckt wie: Arbeit, Proletariermilieu, Klassenkampf, Streik und Revolte. Das sind auch Aspekte, die da mit rein spielen. Der Name des Films ist „Gegenteil von Grau“ – was habt Ihr euch dabei gedacht? Der Titel weckt ja nicht sofort Assoziationen mit dem Ruhrgebiet?
Matthias: Der Name kommt aus dem Ruhrgebietsfilmteam – „Das Gegenteil von Grau“. Es war auch ein starker Wunsch, das „Ruhr“ nicht in den Vordergrund zu drücken. So ist ja auch der Film gemacht, dass wir nicht, sage ich mal, die alte Geschichte erzählen. Es sind zwar einige Industriebauten zu sehen. Es kommt mal ein Arbeiter vor, der jetzt in Pension ist und erzählt wie sein Leben war. Oder es ist ein Buchladen, der die Geschichte der Arbeitsmigrant*innen mit aufnimmt. Also viele wichtige Aspekte, aber es ging im Wesentlichen darum, neue Initiativen vorzustellen, die quasi auf die Reaktion und ein Stück auch auf diese Krise der Arbeit und die Veränderung reagieren. Es gibt auch einen gewissen Unwillen von den ganzen Initiativen, ob es „Netzwerk X“ oder „Recht auf Stadt Ruhr“ ist – diese Metropolengedanken oder Kulturhauptstadt Essen oder all das, was es gibt, dieses Labeln soll gebrochen werden.
Man bleibt aber doch auch im Film da drin. Das ist ja klar, dass sind die materiellen und geistigen Grundlagen.
Bernd: Das „Gegenteil von Grau“, was wäre das?
Matthias: Vielleicht ist es bunt, ja? Und damit haben wir schon wieder das Ruhrgebiet, was ja auch wirklich mit grau assoziiert wird und in den 70er und 80er Jahren, 90er Jahren, als die Schlote noch voll qualmten, da war es grau und dunkel. Das wissen die Leute und da gibt es eine Art Veränderung. Hier ging es aber wirklich darum, diese kleinen versteckten, konkreten, utopischen Momente hochzuholen. Es gibt ja auch eine alte Geschichte von interessanten Arbeiterjugendkulturzentren: Druckluft Oberhausen und so weiter. Das haben wir nicht porträtiert. Oder der Bahnhof Langendreer in Bochum. Die sind ja auch erkämpft worden. Aber das waren quasi die Kinder der Arbeiter*innen. Wo die Arbeiter*innen noch in Lohn und Brot waren. Die Initiativen heute sind neu. Die Leute sind eigentlich außerhalb der Industriearbeit, die diese betreiben, trotz ihrer unterschiedlichen biografischen Situation. Es kommen ja auch Senioren vor, genauso wie ganz junge Leute, die versuchen etwas zu besetzen.
Bernd: Was mich besonders gefreut hat, ist, dass in „Gegenteil von Grau“ auch anarchistische Projekte portraitiert werden, wie das „Black Pigeon“ und viele antiautoritäre Projekte, die dem Anarchismus nahe stehen. Für die Hörerinnen und Hörer, die den falschen Eindruck haben: Anarchie sei Chaos und Anarchismus sei die Lehre vom Chaos und vom Terror. Was ist für Dich Anarchismus? Was ist Anarchie?
Matthias: Für mich wäre da das „Black Pigeon“ ein gutes Beispiel. Das ist ein wunderbarer Laden, der in Dortmund umgezogen ist und jetzt ein Lokal betreibt, gleich angegriffen wurde von Neonazis. Dessen Verständnis von Anarchismus sehe ich auf eine Art als Bildungsarbeit. Es geht um emanzipatorische Bildungsarbeit und einen Raum herzustellen, wo ein geistiger Freiraum herrscht und gedacht werden kann. Und nicht das gedacht werden kann, was scheinbar gedacht werden muss oder was gedacht werden soll oder was ganz unausweichlich ist. Also, da steckt ein kreatives geistiges Potential darin.
Merlin Sandow: Du hast ja gerade über die Projekte im Ruhrgebiet gesprochen, die Du in deinem Film erlebt hast. Das ist so ein bisschen der Ist-Zustand. Was siehst Du denn perspektivisch fürs Ruhrgebiet?
Matthias: Das ist nicht leicht so eine makroökonomische Ebene da aufzumachen. Das Ruhrgebiet ist ein interessanter Ort, weil es eben auf eine Art diese Implosion der industriellen Welt dort vor Ort gibt, in einem riesigen städtischen Raum. Dieser Metropolenbegriff einerseits ist natürlich Marketing und Illusion. Und gleichzeitig, wenn man von „Google Earth“ nachts guckt, dann sieht man doch, es ist ein riesiger bebauter Raum. Die Menschen sind alle noch da, Millionen Menschen. Da, wo Menschen zusammenkommen, steckt immer ein kreatives Potential. Das kann auch schiefgehen und, wie in andern Ländern und Regionen, gerade in kriegerischen Ebenen enden. Das glaube ich aber nicht für diese hochlohn- und hochindustrialisierten Gegenden des Kapitalismus. Die Zentren werden wahrscheinlich stabil gehalten und die ganze Gesellschaft muss drüber nachdenken, wie diese Millionen Menschen ohne die klassische Industriearbeit zusammenleben können. Da entsteht eine ganze Menge.
Es gibt ja auch aus Reihen der Bürgerschaft heraus immer schon die Idee des Ehrenamtes. Das würde ich persönlich jetzt ein bisschen kritisieren, weil es natürlich schwierig ist, Leute engagieren sich ehrenamtlich und haben aber kein richtiges Einkommen, um die Lebenshaltungskosten selbst bestreiten zu können. Das ist schwierig, aber das Potential, für andere, mit anderen was zu machen, zu kooperieren, zusammen zu kommen, Ideen zu entwickeln und dann tatkräftig für die Gesellschaft zu arbeiten, das ist eine wunderbare Sache. So stehen diese Initiativen eher so wie kleine Bausteine, die zeigen, was Anderes möglich ist. Es ist klar, wenn die Leute solidarische Landwirtschaft machen, in dem Stil, dann würden sie vielleicht verhungern. Sie können also Aldi oder die Bio Company – je nach Einkommen – nicht ersetzen. Aber umgekehrt zeigen sie, man kann in einem gemeinsamen Projekt etwas erwirtschaften, gutes Gemüse für alle. Das kann dann wieder zum einen oder anderen Projekt gehen: Im Film beispielhaft an die „Velokitchen“, ein kleines Fahrradprojekt, wo viele Kinder unterstützt werden, viele Leute mit wenig Geld ihre Fahrräder reparieren können und ein gewisser Zusammenhalt ist. Da gibt es so eine Art Austausch. Ein anderes Beispiel, ganz wunderbar, kitev Oberhausen. Oberhausen war ja eine totale Industriestadt und hatte dann diese neoliberale Sünde: Das Centro in Oberhausen Anfang der 90er, wo wirklich dereguliert wurde. Der ganze Niedriglohnsektor wurde da, würde ich sagen, im Massenmaßstab eingeführt. Da sind jetzt mitten in der Stadt im Bahnhofsturm und in einem zentralen Wohngebäude, ich glaube „Vonovia“ unterhält das, die „Refugees’ Kitchen“ und das Projekt „kitev – Kultur im Turm“ eingezogen. Und die machen da etwas ganz Anderes. Die arbeiten mit Geflüchteten zusammen, erstellen die Wohnungen zusammen, laden z.B. Künstler*innen aus Osteuropa ein und bringen etwas nach Oberhausen hinein, wo die Innenstadt eigentlich total implodiert ist, genauso wie die Industriearbeit auf eine Art weg ist. Also in diesen Widersprüchen ist das, gerade da, wo es am dunkelsten ist, würde es bei „Ton Steine Scherben“ heißen, oder wo wenig oder es ganz schrecklich ist, da ist auch das Rettende nah. Erst aus der Krise kommt auch etwas. Da kann man das sehen und da bin ich ganz optimistisch. Für mich ist das ein prototypisches Gebiet. Was es oft gibt, ob in Leeds, ob in Manchester, ob in Turin und so weiter, das ist ein weltweites Phänomen. Als Symbol für diese ganze Frage steht die US-amerikanische Autostadt Detroit.
Merlin: Sowohl an anderen Orten als auch in Detroit, zeigt sich aber auch, dass, wenn Initiativen entstehen und alternative Projekte, das teilweise auch mit Aufwertung einhergeht. Wie siehst Du das Risiko, dass zum Beispiel durch viele Kunstinitiativen, die ein sehr bestimmtes Publikum anziehen – ich würde nicht sagen, dass es das gleiche ist wie bei einem solidarischen Landwirtschaftsprojekt – eine Aufwertung stattfindet in Stadtteilen: Reichere Personen dahinziehen und gleichzeitig die Mieten steigen. An Orten wie in Berlin und Hamburg hat man das ja teilweise schon. Wie siehst Du das allgemein und wie mit Bezug aufs Ruhrgebiet?
Matthias: Das ist ambivalent. Erstmal würde ich sagen, jede Form der Aufwertung oder Modernisierung ist an sich positiv, wenn die sozialen Aspekte mitgedacht werden. Wenn man das kurz am Beispiel Berlin betrachtet: Ein großes Problem ist die energetische Modernisierung. Da wird eben ökologisch ein Haus aufgewertet. Das ist eine super Sache – eine bessere CO2-Neutralität hinzu bekommen, schlecht ist wenn die ganzen Kosten auf die Mieter*innen umgelegt werden und die dann ihre Wohnung verlieren oder auf einmal eine Arbeit machen müssen, die sie gar nicht wollen, um noch mehr Geld zu erwirtschaften. Da wird dann das Ökologische gegen das Soziale ausgespielt. Das ist sinnlos, aber man muss eben gucken, wie kommen die Gesetze so zu Stande, dass es so ist. Aber im Ruhrgebiet, würde ich sagen, kann man von so blanker Gentrifizierung in der Art gar nicht sprechen. Nehmen wir ein konkretes Beispiel aus dem Film: „Lokal Harmonie“, Duisburg Ruhrort, da leben viele, viele Tausend Menschen zusammen mit mehr oder minder wenig Kultur und wenigen Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel in der „Schimanski-Gasse“ noch eine kleine Kneipe, ansonsten ist wenig los. Und da ist das „Lokal Harmonie“, das überregionalen, lokalen, internationalen Künstler*innen eine Möglichkeit gibt, aufzutreten. Da geht der Hut rum, alle können reinkommen, es können politische Veranstaltungen gemacht werden. Da wird Bewusstseinsarbeit gemacht. Das ist erst einmal etwas ganz Positives und nicht jede Kultur ist automatisch Verdrängung. Das steht immer in einer Ambivalenz. Da geht es natürlich darum, vielen Leuten einen Zugang zu ermöglichen. Es gibt auch Initiativen und auch aus der Bürgerschaft heraus solche Ideen, dass so eine Art, in manchen Städten heißt es dann Kulturtaler oder sonst was, dass Karten, die über sind, an Menschen mit wenig Einkommen gegeben werden können.
Das sind erst einmal karitative Ideen, das würde ich sagen, ist immer nicht so gut, weil es ja voraussetzt, dass es diese Armut überhaupt gibt. Und die Armut ist in so einer reichen Gesellschaft völlig unnötig. Aber sie ist eine Realität für viele Menschen. Damit muss umgegangen werden. Dann sind auch Initiativen, die versuchen gleichzeitig eine Gesellschaftsperspektive aufzubauen und ein anderes Arbeiten, etwas ganz Besonderes, weil die noch einen Aspekt mehr mit reinbringen, der ja bisher unabgegolten und ungelöst ist. Das muss man ja so sehen: Nur weil man eine gute Idee hat, heißt es noch lange nicht, dass sich dadurch die Gesellschaft ändert. Es muss praktisch auch realisiert und praktiziert werden. Auch im Kleinen und das immer jeden Tag aufs Neue.
Merlin: Wie siehst Du denn die Perspektive, Projekte auch größer zu machen? Also zum Beispiel selbstverwaltete Stadtteile? In Griechenland gibt es ja zum Beispiel den Stadtteil Exarchia, wo viel Infrastruktur selbstorganisiert ist, wo es dann hingeht von selbstorganisierten Bäckerbetrieben bis hin zu Sozialen Zentren. Wie siehst Du die Perspektiven, so etwas auch langfristig z.B. im Ruhrgebiet aufzubauen?
Matthias: Ich kann nicht sagen, ob das so einfach möglich ist. Es gibt Nachfragen oder Anfragen aus Griechenland zum Film. Der Film „Das Gegenteil von Grau“ wird im Moment ins Griechische übersetzt. Auch „Mietrebellen“ wurde schon ins Griechische übersetzt, weil es einen Bedarf gibt, natürlich, weil das „ein sehr spannendes Land ist“, weil es eben so heruntergewirtschaftet ist, heruntergewirtschaftet wurde aus vielen Perspektiven, und natürlich auch unter der deutschen Austeritätspolitik besonders leiden musste. Die Menschen sind jetzt gezwungen, Krankenhausprojekte und ähnliches, wirklich soziale Infrastruktur selbst zu organisieren, aber eben nicht über die monetäre Ebene – die Bezahlung – sondern um diese Versorgung und das, was man fürs tägliche Leben braucht, zu erhalten. Die Not bringt diese Projekte auch hervor.
Ich freue mich, dass es diese Anfragen aus Griechenland gibt und dass wir die Möglichkeit der Übersetzung und Untertitelung haben. Der Film lief zum Beispiel gerade im Kosovo. Im Kosovo denkt man sicherlich, im reichen Deutschland sei alles in Butter und allen gehe es irgendwie gut. Man kennt ja die Widersprüche nicht, die wiederum hier sind. Da ist es auch gut zu sehen, dass es hier solche Ansätze gibt. Ob man gleich eine Stadtteilarbeit, die es mal in den 70er und 80er Jahren gab, in der Form revitalisieren kann, das geht glaube ich alles nicht so schnell. Da sind viele Fragen. Ich glaube, durch ein reines Netzwerk, durch einen Netzwerkgedanken, wie z.B. „Recht auf Stadt Ruhr“ den vertritt, ist das nicht zu bekommen. Man kann nicht ein Netzwerk bilden und eine Zentrale – sondern man kann Ideen hereingeben, aber im Endeffekt sind es immer kleine konkrete Projekte, die dann über sich hinauswachsen und Verbindungen aufbauen. Dann entsteht etwas Realitätstüchtiges. Wenn das dann mehr Kraft hat als die bürgerliche Gesellschaft, die ja sagt „Es ist in Ordnung, dass jemand hungert, wenn er keine Arbeit findet“, dann kann man sagen, wir machen es besser.
Bernd: Du hast Soziologie studiert. Wie bist Du aufgewachsen, wie hast Du Dich politisiert? Wie wurdest Du ein politischer Filmemacher?
Matthias: Ich bin in einer ländlichen Region bei Osnabrück und in kleinbürgerlich-proletarischen Verhältnissen aufgewachsenen, aber mit sehr lieben Eltern und dem Glück, dann auch Abitur machen zu können. Sehr viele Jahre habe ich als Jobber gelebt und nie Interesse daran gehabt, eine Berufsidentität in dem Sinne, über eine Ausbildung zu haben, weil ich eine Idee habe vom Menschen als Renaissance-Mensch: Dass man viele Talente und viele Möglichkeiten hat und diese ausbilden soll. Dass es auch sinnvoll ist, eine Ausbildung zu machen als Handwerker oder so, dass würde ich auf jeden Fall sagen. Aber diese extreme Spezialisierung, die hat mich immer ein bisschen gestört. Irgendwann ging die Mauer auf. Da sind aus meiner Heimatstadt Osnabrück, wo ich als junger Erwachsener hingezogen bin, einige hundert wunderbare Leute nach Berlin gegangen: Prenzlauer Berg, in den Friedrichshain. Die haben da alle möglichen Projekte gemacht. Auf einmal war man da in Osnabrück ganz alleine. Da haben wir politische Arbeit gemacht – Stadtteilarbeit – mit ein paar Leuten und irgendwann habe ich mir überlegt: Ich studiere doch noch. Dann habe ich Soziologie, Philosophie und Literaturwissenschaften studiert, mit Gewinn. Zu der Zeit hatte ich aber auch immer schon ein großes Interesse für Film, Filmmuseen, alle möglichen Sachen gehabt, fürs European Media Art Festival mitgearbeitet in Osnabrück und mich einfach interessiert. Irgendwann bin ich dann ganz nach Berlin gegangen, zuvor bin ich immer gependelt und habe Videos produziert, schon längere Zeit für Initiativen, für politische Gruppen, aber auch für solche Sachen, für den Ärztetag oder für Ärzte, die im Methadonprogramm arbeiteten. Es ging immer auch um die soziale Frage. Auch mal für den DGB und so weiter. Dann bin ich im Laufe der Zeit, durch die Intensität der Videos, in diese Filmebene reingegangen und habe dann einen Film gemacht, der auch in Münster spielt. Der heißt „Glotz den ApoCarlypso“. Es ist eine Biographie mit einem Mann, der seine Lebensreise macht. Das geht schon in Richtung Langfilm mit 40 Minuten. Danach habe ich den Film „Mietrebellen – Widerstand gegen Ausverkauf der Stadt“ zusammen mit einer Freundin, Gertrud Schulte-Westenberg, über die Problematik der steigenden Wohnkosten in Berlin produziert. Der wurde relativ oft gespielt: alleine 300 Mal im Kino, in zwanzig Ländern gezeigt, in zehn Sprachen übersetzt. Ich bin dann über diesen Film weiter vorgegangen, habe viele Initiativen im Ruhrgebiet kennengelernt. Daraus ist dann die Realisierung von „Das Gegenteil von Grau“ entstanden. Durch „Mietrebellen“ hatte ich mir ein kleines Renommee in der Stadt erspielt. Ich habe mit dem Film etwa 250 Abendveranstaltungen in 80 Städten gemacht, weil das Thema Wohnkosten überall drängend ist und das Armutsrisiko durch hohe Wohnkosten steigt auch massiv in der Bundesrepublik, wo die Leute ja zum Teil mit Einkommen noch ganz gut versorgt sind. Aber da klafft quasi eine neue Lücke, das ist quasi eine neue soziale Frage in Berlin, sehr spürbar. Da hatte ich dann das Glück, eingeladen zu werden, als Juror zu arbeiten für die Berlinale für den Friedensfilmpreis. Das ist eine besondere Freude und vielleicht auch Ehre in solchen Bereichen dann tätig zu sein. Über so seinen Film in Berlin schließt sich dann ganz viel auf.
So kommt man dann auch als Seiteneinsteiger mit quasi einem geisteswissenschaftlichen Aspekt und gleichzeitig als Jobber, der auch Industriearbeit kennt und die unterschiedlichen Formen der Arbeit, dahin, doch auch Filme produzieren zu können. Wir haben ein kleines Team in Berlin und arbeiten da intensiv zusammen, sind quasi Produzenten, Filmemacher und politisches Team in einem. Wir scheuen uns aber auch nicht, weiterhin einfach Videos zu machen für Gruppen, die das brauchen.
Merlin: Du hast gerade gesagt, dass Du gar nicht angefangen hast erst zu studieren und dann aktiv zu werden, was ja heute vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Magst Du das näher ausführen?
Matthias: Ich bin Jahrgang 1969, also habe ich den Wärmestrom von 68 noch ein Stück mitbekommen. Als ich Abitur gemacht habe und quasi ins Erwachsenenleben ging, dachte ich so: „Super, jetzt kann man loslegen, jetzt kann man was machen“. Habe dann aber in meiner offenherzigen Naivität festgestellt, es ist eben nicht so. Also ich komme jetzt nicht aus einem Haushalt, wo jetzt so viel klassische Bildung ist oder politische Bildung. Es gab ein Bewusstsein, aber ich habe mir dann viel selbst erarbeitet und es war ja dieser Epochenbruch. Auf einmal war der Realsozialismus, wo ich persönlich vielleicht nicht glücklich geworden wäre, zusammengebrochen. Der Kapitalismus hatte gesiegt und das Motto war weltweit Demokratie, weltweite Marktwirtschaft: „Alle werden versorgt werden“.
Das ist ja nicht der Fall, das war auch absehbar. Eine vielleicht neomarxistische Idee verbreitete sich, dass Arbeit nicht die letzte Idee des Menschen ist, sondern Arbeit eigentlich dazu da ist, auch ein gutes Leben herzustellen. Es gab Ideen von André Gorz und anderen, dass die Arbeit verschwindet. Zu der Zeit war die Gruppe „Krisis“ renommiert. Die hat auch über die Krise der Arbeit geschrieben. Das ist auch das Thema im Ruhrgebiet. Ich bin auch zu Demonstrationen in Rheinhausen gefahren, wo die Arbeiter*innen, die Stahlarbeiter*innen für ihre Arbeitsplätze gekämpft haben. Zu der Zeit war auch Bischofferode, der Osten wurde abgewickelt und so weiter. Ich habe aber gespürt, dass diese Form der Industriearbeit nicht die Zukunft ist: „Was ist es denn dann?“ Da habe ich eine Suchbewegung gemacht und wollte mich nicht beruflich festlegen. Deshalb bin ich da reingegangen. Zu der Zeit gab es auch die „Glücklichen Arbeitslosen“. Ich finde Arbeit aber eigentlich positiv, bin von meinem Wesen her kein glücklicher Arbeitsloser. Also habe ich gejobbt, habe versucht in der Gesellschaft tätig zu sein, auch über Erwerbsarbeit. Es ist klar, man muss sich reproduzieren, man muss die Miete zahlen, man will auch jemandem mal etwas schenken oder mal ein Getränk ausgeben oder sonst was. Da hatte ich eine Jobber-Identität für mich selbst, also nicht Berufsidentität. Das ist schwer durchzuhalten auf Dauer, weil – jetzt kommt ein entscheidender Punkt: Zu der Zeit gab es auch die große neoliberale Wende, die in Deutschland spürbar wurde. Thatcher, Reagan, Kohl – das ging richtig los. Was vielleicht in den 70ern und 80ern noch gut ging, da konnte man Nachtschicht irgendwo bei VW machen und dann konnte man mit zwei Monaten Arbeit vielleicht wiederum zwei Monate freimachen, um an einem Buch zu schreiben oder mit Leuten eine Reise zu machen oder ein Projekt aufzubauen. Das ging dann nicht mehr. Das heißt auch, die Normalarbeitsplätze wurden dereguliert. Es gab „5000 mal 5000“ in Wolfsburg. Ganz viel geschah und die sogenannten Normalarbeiter*innen konnten auch nur noch so gerade von ihrer Arbeit leben. Die Zeitarbeit wurde vermasst. Wir haben das Problem, dass die Leute in Ländern wie den USA, aber langsam auch schon in Deutschland und Europa ein, zwei, drei Jobs machen müssen, um über die Runden zu kommen. Also ging das Prinzip des Jobbens nicht mehr, weil man dann quasi Postbote von morgens bis abends war und auf keinen grünen Zweig kam. Da musste eine andere Strategie her, weil ich ja auch kreativ mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollte. Ich scheue mich aber nicht auch vor klassischer Arbeit. Mein persönlicher Traum wäre: Ein Tag in der Woche als Filmemacher, einen Tag in der Kita, ein Tag im Klärwerk, einen Tag in der Bäckerei und einen Tag in der Hochschule – so stelle ich mir das vor.
Bernd: Das „Gegenteil von Grau“ könnte man als „Graswurzelfilm“ bezeichnen, also ein Film aus einer solidarischen Perspektive von unten, aus der Sicht sozialer Bewegungen. Das Thema Gegenseitige Hilfe wird auf die Tagesordnung gesetzt, Projekte, die beispielhaft Gegenseitige Hilfe praktizieren, werden vorgestellt. Was war die Motivation, so einen Film zu drehen? Wird er irgendwann auch im Fernsehen zu sehen sein? Wie lange tourt Ihr noch?
Matthias: Die Filmidee ist: Wir wollen zusammenarbeiten. Wenn wir alle aus den Fabriken geflogen sind und aus den normalen Arbeitsplätzen, dann ist das einerseits schrecklich, weil dann diese alte Solidarität, die Möglichkeit zusammenzuarbeiten für viele Menschen verloren geht. Sie werden atomisiert, sie vereinzeln, vereinsamen und verarmen. Auf der anderen Seite ist die Industriearbeit auch immer Knechtung gewesen und Ausbeutung. Also braucht es neue Wege. Bei diesen Projekten sieht man viele Möglichkeiten der solidarischen Hilfe, auch des Sich-Respektierens in seiner Unterschiedlichkeit und sich trotzdem unter die Arme zu greifen, aber auch ein Stück Utopie – wie etwas entwickelt wird, das es bisher noch gar nicht gibt. Also eine Art Übung, ein Probieren. Das fängt klein an, da gibt es Scheitern, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Das war ein starkes Motiv für mich, das nach vorne zu bringen. Wir sollten auch ein Stück visionär denken: Die Gesellschaft kann viele Fragen nicht beantworten; nicht nur die ökologische nicht, sondern, wirklich, die eines friedlichen und reichen, luxuriösen Zusammenlebens für alle Menschen auf dem Planeten. Die Fragen müssen auch hier gestellt und bearbeitet werden, wo wir noch relativ viel Zeit und Bildung haben, nicht in Kriegen und in totaler Armut versinken. Also, es ist ein wichtiger Ort.
Der Film läuft immer noch in verschiedenen Kinos und Städten. Er läuft da, wo er gebraucht wird. Wenn Initiativen da sind, die den Film zeigen wollen, dann sollen sie sich gerne melden, oder wenn es Kinos gibt, die interessiert sind oder Initiativen gehen an lokale Kinos heran. Es gibt unterschiedliche Kontexte. Das ist einerseits ein Bewegungsfilm, aber andererseits auch ein klassischer Dokumentarfilm, der auch Menschen, die sich mit dem Thema wenig auskennen oder erst mal neugierig sind, einen Einstieg gibt.
Bernd: Was ist Thema Deines nächsten Films? Was planst Du an neuen Projekten?
Matthias: Wir arbeiten zur Wohnungsfrage in Europa. Jetzt fahren wir nach Madrid. Und wir arbeiten zu der Frage der Immobilienwirtschaft. Ein anderes Projekt, was ich seit längerem verfolge, ist die Geschichte des Antifaschismus in der Bundesrepublik und das tut natürlich bitter Not heutzutage.
Merlin und Bernd: Herzlichen Dank für das Gespräch!
Interview: Bernd Drücke, Merlin Sandow
Anmerkungen:
1) Weitere Infos: www.gegenteilgrau.de
Der schwarzrote Faden. Das Ruhrgebiet mal ganz anders: Im Dokumentarfilm „Das Gegenteil von Grau“ werden linke Kollektive vorgestellt, Artikel von Bernd Drücke, aus: junge Welt, Berlin, 19.6.2017, http://gegenteilgrau.de/2017/06/20/es-geht-um-solidaritaet-das-ruhrgebiet-mal-ganz-anders/
Auf Englisch: http://gegenteilgrau.de/2017/07/05/the-black-red-thread/
2) Webseite des Filmemachers: www.zweischritte.berlin
3) https://beta.nrwision.de/radio-graswurzelrevolution-das-gegenteil-von-grau-filmvorstellung-171004/
Interview aus: Graswurzelrevolution Nr. 423, November 2017, www.graswurzel.net
Freiräume im RuhrgebietDer Dokumentarfilm „Das Gegenteil von Grau“ zeigt den anderen Pott. Bernd Drücke und Merlin…
Posted by Graswurzelrevolution on Dienstag, 24. Oktober 2017